
Wissenschaftlich geprüft von:
Dr. Joachim Bandlow
Übersicht
- Als Allergie wird eine Überreaktionen des Immunsystems auf eigentlich harmlose Umweltstoffe (Allergene) bezeichnet.
- Die Symptome reichen, je nach Allergie, von Niesen, Hautausschlägen, Schwellungen bis hin zu lebensbedrohlicher Anaphylaxie.
- Eine genetische Veranlagung kann die Entstehung einer Allergie begünstigen, darüber hinaus können Umweltfaktoren und ein Ungleichgewicht der Darmbakterien (Mikrobiom) eine Rolle spielen.
- Der Darm spielt eine Schlüsselrolle, da ein großer Teil des Immunsystems in ihm verankert ist.
- Zur Behandlung eignen sich Maßnahmen wie eine (bestmögliche) Vermeidung von Allergenen, Medikamente, Desensibilisierung und gezielte Unterstützung der Darmflora.
Was ist eine Allergie?
Zuallererst: Eine Allergie ist eine Fehleinschätzung des Immunsystems an sich harmloser Substanzen aus unserer Umgebung. Normalerweise schützt uns das Immunsystem vor Krankheitserregern wie Viren oder Bakterien. Bei einer Allergie jedoch stuft es bestimmte Stoffe – sogenannte Allergene – fälschlicherweise als gefährlich ein und löst eine Abwehrreaktion aus.
Zu den bekanntesten Allergenen zählen unter anderem Pollen, Kot von Hausstaubmilben, Tierhaare oder bestimmte Lebensmittel. Bei Allergikern führt der Kontakt mit solchen Stoffen dazu, dass das Immunsystem überreagiert und entzündliche Prozesse in Gang setzt. Die Symptome reichen von harmlosen, aber lästigen Beschwerden, wie zum Beispiel Niesen, tränenden Augen und Hautreaktionen bis hin zu gefährlichen Problemen wie Atem- und Kreislaufproblemen.
Welche Symptome treten bei Allergien auf?
Allergische Reaktionen, ihre Kombination und Intensität sind hochindividuell und hängen von Faktoren wie Empfindlichkeit, Allergenbelastung und dem Kontaktweg ab. Zu den häufigsten Symptomen zählen:
Atemwege:
- Niesen
- Laufende oder verstopfte Nase
- Juckende oder tränende Augen
- Husten
- Atemnot oder pfeifender Atem (Asthma)
Haut:
- Juckreiz
- Hautausschläge
- Ekzeme
- Schwellungen, besonders im Gesicht, an den Lippen oder Augenlidern (Angioödem)
Magen-Darm-Trakt:
- Bauchschmerzen
- Übelkeit und Erbrechen
- Durchfall
Systemische Reaktionen:
- Anaphylaxie (stark erhöhte Herzfrequenz, Blutdruckabfall, Atemnot, Bewusstlosigkeit) – potenziell lebensbedrohlich!
Unterschied zwischen Soforttyp und Spättyp Allergien
Allergien als solche sind Ihnen sicherlich ein Begriff, aber wussten Sie, dass zwischen unterschiedlichen Allergie-Typen unterschieden wird, wie schnell die Reaktion des Immunsystems auf das Allergen erfolgt? Differenziert wird zwischen dem Soforttyp (Typ I) und dem Spättyp (Typ IV). Vereinfacht gesprochen reagiert der Soforttyp kurz und heftig, der Spättyp hingegen langsamer und meist mit anhaltenden Symptomen.
Weitere Unterscheidungsmerkmale sind:
Soforttyp (Typ I):
- Reaktionszeit: Bereits nach Sekunden beziehungsweise wenigen Minuten kann es zu den ersten Symptomen kommen.
- Mechanismus: Als Reaktion auf das Allergen produziert das Immunsystem die Antikörper Immunglobulin E (IgE). Vereinfacht gesagt veranlassen sie unter anderem die Mastzellen, den Botenstoff Histamin und andere entzündungsfördernde Substanzen freizusetzen.
- Häufige Allergene: Pollen, Tierhaare, Hausstaubmilben, Nahrungsmittel (z. B. Erdnüsse oder Eier), Insektengifte, bestimmte Medikamente.
- Symptome: Niesen, laufende Nase, juckende Augen, Nesselsucht, Asthmaanfälle, anaphylaktische Reaktionen.
Spättyp (Typ IV):
- Reaktionszeit: Symptome treten 24 bis 72 Stunden nach Kontakt mit dem Allergen auf.
- Mechanismus: Die T-Zellen des Immunsystems erkennen das Allergen und setzen daraufhin Zytokine frei, die eine Entzündungsreaktion auslösen. Im Gegensatz zum Typ I wird dieser Prozess allerdings nicht durch Antikörper, sondern durch zelluläre Immunreaktionen vermittelt.
- Häufige Allergene: Nickel (in Schmuck), Duftstoffe, bestimmte Chemikalien (z. B. in Kosmetika oder Reinigungsmitteln), Latex.
- Symptome: Kontaktdermatitis (Hautausschläge, Rötungen, Juckreiz, Bläschenbildung), chronische Ekzeme.
Wie entstehen Allergien?
Die Entstehung einer Allergie ist ein vielschichtiger Prozess, der durch ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren beeinflusst wird – darunter genetische Veranlagung, immunologische Faktoren, Umweltbedingungen sowie der Zustand des Verdauungssystems. Allergien entstehen nicht über Nacht, sondern entwickeln sich über mehrere Schritte hinweg.
Genetische Veranlagung
Allergien treten häufiger auf, wenn sie bereits in der Familie vorkommen. Wenn ein oder beide Elternteile Allergiker sind, steigt das Risiko, dass auch ihre Kinder eine Allergie entwickeln. Darüber hinaus können bestimmte Gene die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das Immunsystem überempfindlich auf harmlose Stoffe reagiert. Und diese genetische Veranlagung kann die Grundlage für weitere der folgenden Faktoren liefern.
Sensibilisierung des Immunsystems
Der erste Schritt zur Entwicklung einer Allergie ist die sogenannte Sensibilisierung. Dabei stuft das Immunsystem ein eigentlich harmloses Allergen (etwa Pollen oder ein Nahrungsmittel wie Eier) irrtümlich als gefährlich ein. In der Folge bildet der Körper spezielle Immunglobulin-E-Antikörper (IgE), die sich an bestimmte Abwehrzellen anlagern – in diesem Fall Mastzellen und Basophile. Diese Zellen sind im gesamten Körper verteilt, vor allem in der Haut, in den Atemwegen und im Magen-Darm-Trakt.
Auslösen der allergischen Reaktion
Kommt der Körper später erneut mit demselben Allergen in Kontakt, binden die IgE-Antikörper das Allergen diesmal sofort. Dies führt zur Aktivierung der Mastzellen, die daraufhin entzündungsfördernde Substanzen wie Histamin freisetzen. Diese Ausschüttung ist es, die die typischen allergischen Symptome nach sich zieht: Juckreiz, Schwellungen, Hautausschläge, tränende Augen oder Atembeschwerden.
Einfluss von Umweltfaktoren
Auch äußere Einflüsse spielen eine wichtige Rolle. Wer regelmäßig in hohem Maße mit potenziellen Allergenen wie Pollen, Hausstaubmilben oder Tierhaaren in Berührung kommt, trägt ein höheres Risiko, eine Allergie auszubilden. Zu guter Letzt kann Umweltverschmutzung das Immunsystem zusätzlich belasten, zum Beispiel durch Feinstaub oder chemische Reizstoffe.
Die Rolle des Darms: das Mikrobiom
Weniger bekannt, aber zunehmend erforscht, ist der Einfluss des sogenannten Darmmikrobioms auf die Entstehung von Allergien. Dieses winzig kleine Ökosystem besteht aus Billionen von Bakterien, die sich auf einige Hundert Gattungen aufteilen. Kurz: Sie sind unglaublich zahlreich und äußerst vielfältig – und sie haben enormen Einfluss auf den gesamten Körper. Auch auf das Immunsystem. Gerade wenn dieses Mikrobiom gestört ist, kann sich dies auch auf die Ausprägung einer Allergie auswirken. In einem späteren Abschnitt erfahren Sie mehr über diesen faszinierenden Zusammenhang.
Vereinfacht schon einmal vorweg: Eine vielfältige und stabile Darmflora unterstützt ein funktionsfähiges und „richtig eingestelltes“ Immunsystem. Ungleichgewichte im Darmmikrobiom – etwa durch ungesunde Ernährung oder häufige Antibiotikagaben – können dagegen das Risiko für allergische Reaktionen deutlich erhöhen.
Die Rolle des Darms: die Hygienehypothese
Sauberkeit ist in vielen Lebensbereichen wichtig, um Hygiene zu gewährleisten. Schließlich galten Bakterien lange Zeit vor allem als Krankheitserreger – ein Bild, das die Mikrobiomforschung in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend verändert hat.
Doch wie in vielen Dingen gibt es auch beim Thema Hygiene ein „Zuviel“, insbesondere in den entscheidenden Phasen der kindlichen Entwicklung. Ein zu steriles Umfeld in der frühen Kindheit – also wenig Kontakt zu Mikroben in der Umwelt – kann dazu führen, dass das Immunsystem zu wenig Trainingsreize erhält. Das kindliche Darmmikrobiom, das eine zentrale Rolle bei der „Erziehung“ des Immunsystems spielt, bleibt dabei unterentwickelt. Die Folge kann eine fehlgeleitete Reaktion auf harmlose Umweltstoffe sein – also eine Allergie.
Gerade weil dieser Gedanke zunächst kontraintuitiv wirkt, sorgte die sogenannte Hygienehypothese in der Wissenschaft für enormes Aufsehen. Die These stammt vom britischen Epidemiologen David Strachan, der schon Ende der 1980er Jahre beobachtete, dass Kinder mit älteren Geschwistern seltener an Heuschnupfen litten – offenbar, weil sie häufiger mit Keimen in Berührung kamen. In den Folgejahren bestätigten immer mehr Studien diesen Zusammenhang. Besonders aufschlussreich war eine US-amerikanische Untersuchung mit über 1.200 Neugeborenen: Kinder, die per Kaiserschnitt geboren wurden, hatten ein fünffach höheres Risiko, Allergien zu entwickeln. Der Grund: Beim natürlichen Geburtsvorgang übernehmen die Babys über den Kontakt mit dem Mikrobiom des Geburtskanals erste, wichtige Darmbakterien – dieser „Startimpuls“ fehlt bei einem Kaiserschnitt.
Ein weiteres eindrucksvolles Beispiel liefert die sogenannte „Bauernhof-Studie“ aus Tirol mit über 27.000 Kindern. Die Forscher fanden heraus, dass Kinder, die auf Bauernhöfen aufwachsen, deutlich seltener unter Allergien leiden als Stadtkinder – insbesondere Heuschnupfen trat bei Letzteren etwa dreimal häufiger auf.
Die Erklärung: Kinder auf dem Land kommen von klein auf in engen Kontakt mit einer Vielzahl an Mikroorganismen – sei es durch Tiere, Stallluft, Erde oder frische Lebensmittel. Diese mikrobielle Vielfalt prägt das kindliche Immunsystem frühzeitig und lenkt es in eine „tolerantere“ Richtung.
Wie kann man allergische Reaktionen behandeln?
Konventionelle Behandlungsmethoden
Vermeidung von Allergenen
Am effektivsten ist es, Allergene so gut wie möglich zu vermeiden. Das lässt sich aber je nach Allergie nicht immer einfach in die Praxis umsetzen. Daher ist es zuallererst wichtig, die auslösenden Stoffe zu identifizieren. Diese Identifikation erfolgt in der Regel durch einen ärztlich durchgeführten Allergietest. Sobald bekannt ist, worauf der Körper reagiert, lassen sich gezielte Maßnahmen viel einfacher ergreifen.
Konkret können Sie, je nach Fall …
- … milbendichte Bettbezüge verwenden.
- … regelmäßig mit HEPA-Filtern staubsaugen.
- … Luftreiniger verwenden, die Pollen und Tierhaare aus der Luft ziehen.
- … komplett auf bestimmte Lebensmittel oder Haustiere verzichten.
Medikamentöse Behandlung
Zur Linderung akuter Symptome stehen verschiedene Medikamente zur Verfügung. Sie setzen an unterschiedlichen Stellen der allergischen Reaktion an. Sie sind zwar in der Regel sehr effektiv, aber auch mit starken Nebenwirkungen verbunden.
- Antihistaminika: Sie blockieren die Wirkung von Histamin, das für viele Symptome wie Niesen, Juckreiz oder eine laufende Nase verantwortlich ist. Häufig machen sie sehr müde.
- Kortikosteroide: Sie wirken entzündungshemmend. Sie kommen als Nasenspray, Creme oder in Tablettenform bei stärkeren Beschwerden zum Einsatz. Sie können bei übermäßigem Einsatz zu Nasenbluten oder einer Hautverdünnung führen.
- Abschwellende Mittel (Decongestants): Helfen kurzfristig bei verstopfter Nase, sollten jedoch nicht über längere Zeit verwendet werden, da es zu einem Gewöhnungseffekt kommen kann, wodurch die Nasenschleimhäute nach Absetzen des Sprays sogar noch stärker anschwellen können.
- Leukotrien-Rezeptorantagonisten: Sie hemmen entzündliche Botenstoffe und werden häufig bei allergischem Asthma eingesetzt. Kopfschmerzen oder Übelkeit gehören zu den möglichen Nebenwirkungen.
- Mastzellstabilisatoren: Verhindern die Freisetzung von Histamin und anderen Entzündungsstoffen. Sie werden vor allem vorbeugend eingesetzt, etwa bei Heuschnupfen. Sie können gelegentlich zu Magen-Darm-Beschwerden führen.
Spezifische Immuntherapie (Hyposensibilisierung)
Für einige Allergien – etwa gegen Pollen, Hausstaubmilben oder Insektengifte – bietet die allergenspezifische Immuntherapie potenziell eine langfristige Lösung. Dabei wird das Immunsystem über einen längeren Zeitraum an das Allergen gewöhnt. Ziel ist es, die Überempfindlichkeit schrittweise zu verringern oder ganz zu beseitigen. Diese Therapie erfolgt entweder über regelmäßige Spritzen unter die Haut oder in Form von Tabletten oder Tropfen.
Formen der Immuntherapie:
- Subkutane Injektionen (SCIT): regelmäßige Spritzen unter die Haut
- Sublinguale Therapie (SLIT): Tropfen oder Tabletten unter der Zunge
Diese Behandlungsform erfordert Geduld – sie erstreckt sich meist über bis zu fünf Jahre. Der Erfolg ist dabei leider nicht selten ungewiss. Manche Patienten berichten davon, dass sich die Symptome nach Ende der Therapie wieder verstärken. Auch sollte man insbesondere bei der subkutanen Immuntherapie den Organisations- und Zeitaufwand nicht unterschätzen, da alle ein bis zwei Wochen Arztbesuche terminiert werden müssen.
Notfallbehandlung bei schweren Reaktionen
Bei einer schweren allergischen Reaktion, etwa einem anaphylaktischen Schock, handelt es sich um einen medizinischen Notfall. Hier muss sofort gehandelt werden.
Betroffene, denen ihre Allergie bereits bekannt ist, sollten jederzeit einen Adrenalin-Autoinjektor griffbereit haben. Diese Injektion kann lebensrettend sein, da sie die allergische Reaktion schnell unterdrückt.
Ein neuartiger Ansatz aus der Forschung
Unterstützung des Darmmikrobioms
Wie bereits erwähnt, spielt das Darmmikrobiom bei der Entwicklung von Allergien eine entscheidende Rolle – insbesondere dann, wenn die Bakterienvielfalt und -vielzahl reduziert sind. Das kann aufgrund von chronischem Stress, einer ungesunden Ernährung oder bestimmten Medikamenten (z. B. Antibiotika) der Fall sein.
Durch die Zufuhr von Mikrokulturen, wie sie in fermentierten Lebensmitteln oder spezifischen Mikrokulturenpräparaten vorkommen, kann dieses natürliche Gleichgewicht unterstützt werden. Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, die Ernährung um präbiotische Lebensmittel zu ergänzen, da diese den Darmbakterien als Nahrung dienen und so ihr Wachstum fördern.
Die besondere Rolle des Darms bei Allergien
Eine überwältigende Studienlage konnte in den letzten Jahrzehnten nachweisen, dass die Bakterien in unserem Darm ganz maßgeblich zu unserem Wohlbefinden beitragen. Eine Vorreiterrolle in diesem stetig wachsenden Meer an Erkenntnissen nahmen dabei vor allem das American Gut Project sowie das Human Microbiome Project ein. Die Quintessenz dieser Projekte: Verschiedenste Erkrankungen und Beschwerden lassen sich häufiger als erwartet auf ähnliche Veränderungen des Mikrobioms zurückführen.
Sind etwa die Vielfalt und Vielzahl dieser Bakterien durch die zuvor genannten Umstände gestört, spricht man von einer Dysbiose.
Wie Sie inzwischen wissen, ist eine Allergie nichts anderes als eine Fehlinterpretation des Immunsystems eigentlich harmloser Stoffe aus der Umwelt. Heute weiß man, dass sich rund 70 Prozent aller Immunzellen im Darm befinden. Sogar 80 Prozent der Abwehrreaktionen finden hier statt. Und genau das ist der Grund, warum der Darm seine Finger im Spiel haben kann, wenn es darum geht, ob eine Allergie entsteht oder nicht.
Die regulatorischen T-Zellen gehören zu diesen Immunzellen, die überwiegend im Darm gebildet werden. Wenn nun eine Dysbiose vorherrscht, können nicht mehr ausreichend regulatorische T-Zellen gebildet werden, was in der Folge zu einer überschießenden Immunreaktion, also einer Allergie, führen kann.
Diesen im Detail sehr komplexen Zusammenhang konnten Forscher der University of Chicago in einer in der medizinischen Welt Aufsehen erregenden Studie an Mäusen im Detail entschlüsseln. Dafür wurde der Darm von keimfreien Mäusen – also Mäusen ohne Mikrobiom und ohne Allergien – gezielt mit dem Mikrobiom von Allergikern besiedelt.
Nach diesem Mikrobiomtransfer reagierten die nun nicht mehr keimfreien Mäuse ebenfalls allergisch auf dieselben Fremdstoffe. Es gab also einen eindeutigen Zusammenhang zwischen der Ausprägung des Mikrobioms und der entsprechenden Allergie. Außerdem konnten die Forscher in diesem Fall auch ein reduziertes Niveau der sogenannten regulatorischen T-Zellen nachweisen.
Das war aber noch nicht alles: Die Forscher wollten überdies herausfinden, ob dieser Mechanismus auch in die andere Richtung funktioniert. Dafür führten sie den jetzt allergischen Mäusen das Mikrobiom von gesunden, nicht-allergischen Menschen zu. Das Ergebnis war eindeutig: Die Mäuse reagierten nicht mehr allergisch, ihre Allergieneigung war verschwunden!
Das Resümee: Der Darm beziehungsweise der Zustand des in ihm lebenden Mikrobioms kann ebenfalls eine wichtige Rolle im komplexen Prozess der Entstehung und des Wiederauftretens von Allergien spielen. Zusammenfassend gesagt ist es entscheidend, dass der Darm mit einer hohen Vielzahl und Vielfalt an Bakterien versorgt ist.

Sie haben Fragen?
Dieser Service ist für Sie kostenlos.
Oder direkt kontaktieren via
E-Mail: info@kijimea.de
Telefon: +49 897 879 790 3007
Montag bis Donnerstag:
8:00 bis 16:00 Uhr
Freitag: 8:00 bis 15:00 Uhr
Kijimea Hypo
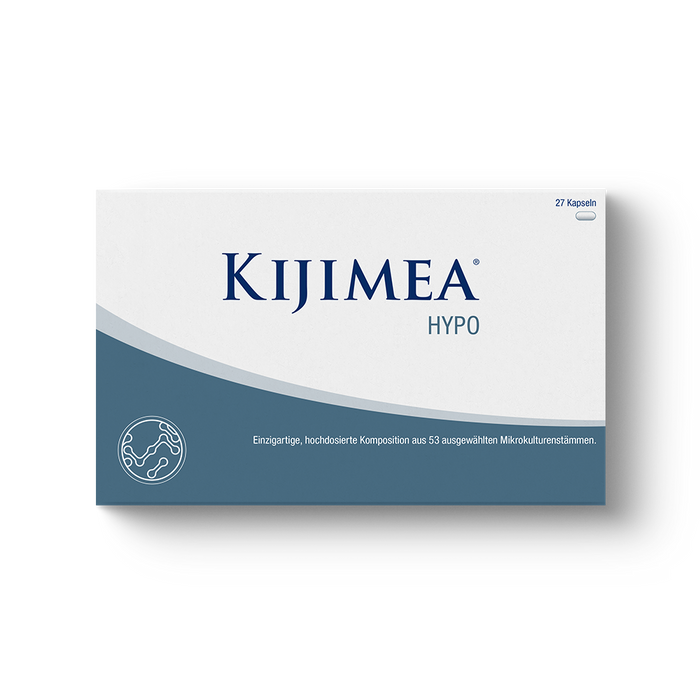
Fazit
Allergien sind eine Überreaktion des Immunsystems auf eigentlich harmlose Stoffe. Sie entstehen durch ein komplexes Zusammenspiel aus genetischer Veranlagung, immunologischen Prozessen und Umwelteinflüssen – wobei ein Faktor zunehmend in den Fokus der Forschung rückt: der Darm. Denn rund 70 % der Immunzellen befinden sich dort. Eine gestörte Darmflora (Dysbiose) kann die Bildung wichtiger Immunzellen hemmen und damit allergische Reaktionen begünstigen. Neben der gezielten Behandlung durch Allergenvermeidung, Medikamente oder Immuntherapie gewinnt deshalb auch die Unterstützung des Mikrobioms durch Ernährung und durch Mikrokulturenpräparate an Bedeutung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Auslöser von Allergien?
Substanzen wie Pollen, Kot von Hausstaubmilben, Tierhaare (bzw. Tierspeichel), Insektengifte, Nahrungsmittel und Schimmelsporen können Allergien auslösen.
Was hilft gegen Allergie?
Gegen Allergien hilft in erster Linie die Vermeidung von Allergenen. Medikamente wie Antihistaminika können Linderung verschaffen, sind aber häufig mit Nebenwirkungen verbunden. Auch die Durchführung einer Immuntherapie sowie die Unterstützung des Darms können hilfreich sein.
Welche Allergene gibt es?
Zu den häufigsten Allergenen gehören Pollen, Hausstaubmilbenkot, Tierhaare bzw. Tierspeichel, Schimmelpilze, Nahrungsmittel, Insektengifte und einige Medikamente.
Starke Allergie - was tun?
Starke Allergiesymptome sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Bei Anaphylaxie kann eine Adrenalininjektion lebensrettend sein.
Disclaimer
Die Informationen auf dieser Seite stellen keine medizinische Beratung dar und sollten nicht als solche betrachtet werden. Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie Ihre regelmäßige medizinische Versorgung ändern.





